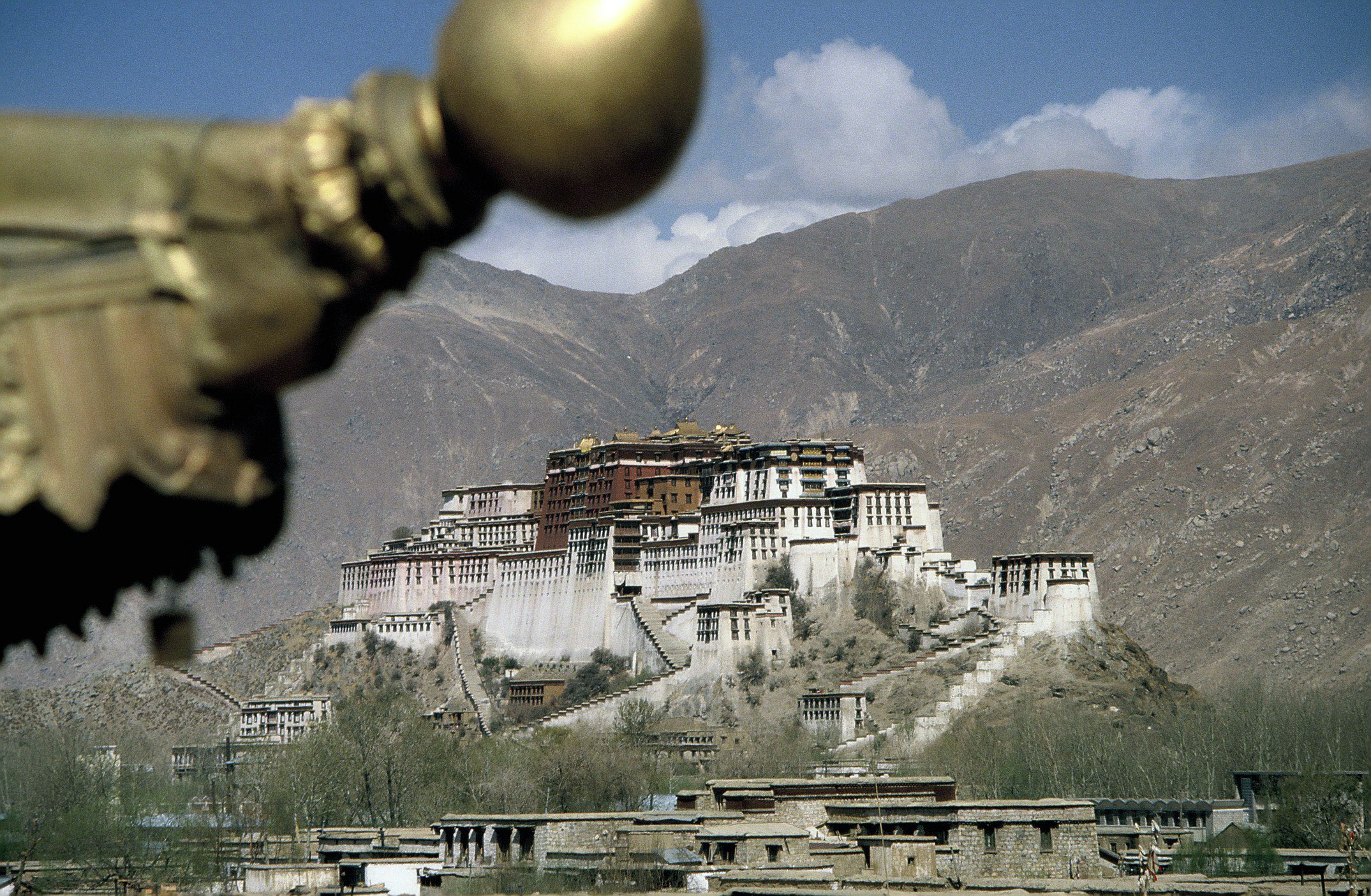Hitlers Manager: Ferdinand Porsche - Der Techniker
Von Peter Adler und Alexander Berkel
Erstausstrahlung: 14. 12. 2004 • 22:15 Uhr • ZDF
Schon bevor er in Hitlers Dienste trat, war Ferdinand Porsche ein Auto-Konstrukteur von Rang und Namen. Doch er war praktisch pleite: »Es war schlecht, sehr schlecht«, notierte sein Sektetär Anfang der Dreissiger Jahre, »wir lebten als Firma von der Hand in den Mund«. Doch am 11. Februar 1933 - nur 12 Tage nach der Machtergreifung - versprach Hitler in der Eröffnungsrede der Berliner Automobil-Ausstellung den Deutschen, sie würden bald ein Volk von Autofahrern werden. Der Traum vom eigenen Auto sollte für jeden »Volksgenossen« erschwinglich sein.
Porsche war begeistert. Auch sein Traum war die Massenmotorisierung. Ehrgeizig und unbeirrbar kämpfte er jahrzehntelang für die Durchsetzung seiner Idee. Doch den etablierten Autobauern waren Porsches immer zu kostspielig und undurchführbar. Nur zu bereitwillig wendet sich Porsche deshalb telegrafisch an den mächtigsten Mann im Staate: »Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer tiefgründigen Rede!«
Porsche wusste um die Vorliebe seines österreichischen Landsmanns für schnelle Autos, für Straßenbau und Motorsport. Porsches und Hitlers Wege mussten zusammenführen - der Volkswagen war die Synthese des unpolitischen Technikers und des technikbegeisterten Verbrechers. Schon Anfang 1934 unterbreitet Porsche dem »Führer« das Exposé für einen »deutschen Volkswagen«, nicht ohne auch den möglichen Einsatz »für militärische Zwecke« zu vergessen.
Hitler reagiert schnell: Er beauftragte Porsche mit der Konstruktion eines »Volkswagens«. Die gesamte deutsche Automobilindustrie soll dieses Fahrzeug gemeinsam produzieren. »Herr Doktor Porsche«, beschloss Hitler die lange Unterredung, »Sie fragen, zu welchem Preis der Wagen hergestellt werden soll? Das kann ich Ihnen sagen - jeder Preis unter tausend Mark ist mir recht...«. Porsche übernahm Hitlers Preisvorstellung, wohlwissend, dass sein Fahrzeug eigentlich nicht unter 1500 RM herzustellen sein würde.
Als sich die deutsche Autoindustrie gegen Hitlers politische Preisgestaltung sperrte, beschloss der Diktator, unter Porsches Regie und unter dem Dach der »Deutschen Arbeitsfront« ein eigenes Werk zu bauen. Das war der Triumph der Idee - genau das, was auch Porsche wollte. Für den »genialen Konstrukteur« (Hitler) wurde Hitler der Erfüllungsgehilfe - umgekehrt galt das allerdings ebenso.
Der Mythos Porsches strahlte umso heller, als er (mit finanzieller Unterstützung Hitlers) mit dem Auto-Union »Silberpfeil« das schnellste Rennauto der 30er Jahre konstruierte. Erstmals angetrieben von einem Heckmotor (wie später auch der Volkswagen). Porsches Fahrer Rosemeyer, Stuck und Co. wuchsen in der NS-Propaganda zu Symbolfiguren deutscher Überlegenheit. Der tödliche Unfall Rosemeyers bei einem Rekordversuch verklärte das Regime zum Heldenmythos.
Doch der »Kdf-Wagen« war der vielleicht wirkungsvollste Propaganda-Coup der Nazis: Der Propagandaspruch »Fünf Mark die Woche musst Du sparen, willst Du im eigenen Wagen fahren« sorgte auch lange nach dem Ende ihrer Diktatur noch für den Satz: »Bei Hitler war doch nicht alles schlecht...«.
Keiner der 300.000 Sparer bekam unter dem NS-Regime eines der Autos, die im neu errichteten Werk in der »Kdf-Stadt«, dem heutigen Wolfsburg, produziert wurden. Denn Porsches Fabrik war schon vor ihrer Fertigstellung für die Kriegsproduktion vorgesehen. Zuerst als Rüstungsschmiede für die Luftwaffe, bald auch für die Motorisierung der Wehrmacht: Mit der (geheimen) Konstruktion des »Kübelwagens« (der Militärversion des Käfers) begann Porsche schon 1937.
Bei der Produktion seines »Kübelwagens« ging es Porsche vornehmlich darum, die Leistungsfähigkeit seines Muster-Werks unter Beweis zu stellen. Denn Porsche wollte im siegreichen Nachkriegsdeutschland als Auto-Produzent die erste Geige spielen. Für seine ehrgeizigen Pläne war er auch bereit, sich auf die ganze Brutalität des Nazi-Regimes zu stützen: 15.000 Menschen, zwei Drittel der Gesamtbelegschaft, schufteten auf dem Höhepunkt der Kriegsproduktion als Zwangsarbeiter im Volkswagenwerk. Als Porsche zweimal ausdrücklich darum bat, lieferte Himmmlers SS den Nachschub auch aus den Konzentrationslagern.
Porsche selbst hatte eine neue Herausforderung im Dienste seines Führers gefunden: Den Bau von Panzern. Nach Hitlers Vorgaben baute er Riesenpanzer, die wie einst die Rennwagen, dem Gegner haushoch überlegen sein sollten. Blind und ergeben folgte Porsche Hitlers Weisungen bis ins Extrem: Der Panzer »Maus« sollte eine rollende Festung werden, mit 188 Tonnen der schwerste Panzer aller Zeiten. Nur zwei Prototypen des militärisch unbrauchbaren Monsters wurden gebaut, den einzigen Erhaltenen entdeckte das ZDF in einem Museum bei Moskau. Ende Dezember 43 wurde Porsche als Vorsitzender der Panzerkommission abgelöst..
Als Porsches Werk im alliierten Bombenhagel in Trümmer fiel, suchte Hitlers Konstrukteur in Höhlen Platz für den Bau von Wunderwaffen: mit dem Bau der V-1 (alias Fi 103) schrieb das Volkswagenwerk (trotz großer technischer Probleme, die auch Porsche beklagte) ein letztes, sinnloses und tristes Kapitel der NS-Kriegswirtschaft.
Nach dem Kriegsende wurde Porsche mit 70 Jahren für ein Jahr zum Kriegsgefangenen der Franzosen - er empfand dies als tiefe persönliche Kränkung. Ein Prozess wurde ihm nie gemacht - juristisch und politisch galt er als unbelastet. Ein strammer Nazi ist der Tüftler aus Böhmen tatsächlich nie gewesen. Doch er wurde zu Hitlers treuem Gefolgsmann, weil der Diktator ihm die Möglichkeit bot, seine Träume zu verwirklichen. Maßstäbe für Recht und Unrecht, für Moral und Ethik jenseits der privaten Sphäre fehlten einem Mann wie Ferdinand Porsche - wie so vielen Technokraten seiner Generation.
Der Film ist die erste umfassende filmische Dokumentation über das Leben Ferdinand Porsches, der bis zu seinem Tod 1951 sich nie zu seiner Biografie äußern wollte. Er verfolgt die wechselhafte Karriere des österreichischen Erfolgskontrukteurs von den Anfängen im Wien der Jahrhundertwende bis hin zur Vorstellung des Porsche 356 zu Beginn der Wirtschaftswunderzeiten Anfang der fünfziger Jahre. Bislang ungesendets Filmmaterial und historisch bis ins Detail verbürgte Spiel-Szenen, sowie Aufnahmen an Original-Schauplätzen zeichnen das Bild eines Lebenswegs, für den das Automobil zum Symbol des Fortschritts wurde.
Die wenigen noch lebenden Zeitzeugen, die Porsche kannten, kommen ebenso zu Wort, wie jene, die seine erfolgreichen Rennwagen und misslungenen Panzermodelle fuhren. VW-Arbeiter der ersten Stunde berichten vom Aufbau des KdF-Werkes und über ihren Traum vom eigenen Auto, ehemalige Zwangsarbeiter von den Arbeitsbedingungen in der Waffenschmiede. Porsches Geschichte ist die Geschichte vom Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg der »Autonation« Deutschland.